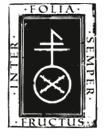LOGBUCH LXVII (2. Dezember 2024). Von Beate Broßmann
1
Wie geht man mit dem Werk einer Ikone um? Sie ist schon heilig, und doch schreibt sie noch. Ein ganzes Weilchen schon die Wiederkehr der kleinen Form: Anhäufelung von Wahrnehmungen, Eindrücken, Gedanken. Miniaturen, Szenen, Phantasien und Anfänge. Wie stellt der Leser es an, sich diesen Kosmos zu erschließen? Soll er nur ein Häppchen am Tag aufnehmen und es auf sich wirken lassen? Vielleicht regt’s die eig’ne Phantasie noch an und macht aus einer Mücke einen Hund? Die Nicht-Rezensentin hat sich nach einigem Hin und Her für einen Mittelweg entschieden: So lange ein Textlein nach dem anderen durchwaten oder -springen, bis das eine kommt, bei dem sie innehält, es wieder und wieder zu sich nimmt, bis es zu einer neuen Erfahrung wird – als sei es die eigene. Oder über Sätze stolpert und die Falltür sich öffnet und sie hofft, es möge dauern, bis einer kommt und die Strickleiter wirft. Oder so lange Anlauf nimmt, bis sie ins Offene emporgerissen wird. Himmel und Keller. Ja, es gibt solche Szenen und Sätze. Aber es gibt auch das andere: Es wird erzählt, eine Szenerie wird entwickelt, eine Handlung beginnt, man ist gerade dabei, sich einzulassen auf die Figuren und dann: Abbruch, Ende, Aus. Man meint den Autor zu hören, wie er hämt: Da ist mir jemand auf den Leim gegangen! Selbst schuld: Was traust du immer wieder einem Dichter?
Doch halt! Eine Ikone tut das nicht. Eine Ikone hat sich ein Etwas dabei gedacht. Bei jedem Wort – ach was: jedem Buchstaben. Wenn so ein Textlein brutal abbricht, heißt das nur – und das solltest du wissen –, daß der Dichter nicht erzählen will. Er ist ja ein Dichter. Kein Erzähler. Ein Chronist. Kein Erfinder. Er katalogisiert, was er hört und sieht – genau in dem Moment, wenn es auf seine Gehirnwelt trifft, die voller Referenzen ist. Ein wohlgefülltes Portefeuille. Dann bricht’s aus ihm heraus – früher oder später. Was er mitteilt und was er für sich behält – alles Ausdruck tiefwurzelnder Lust am Hören und Sehen, seiner Art der Teilnahme am Leben der Welt. Von Neugier getrieben und manchmal auch von einem Liebeswunsch. Das Amalgam von kühn waltendem Gestaltwillen verarbeitet. Wir Leser sollten ihm einfach glauben. Buchstäblich jedes Wort.
Zerbrich dir nur den Kopf, befliß’nes Leserlein! Genieß die seltene Gelegenheit, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! Eine Anleitung gibt es nicht. – Setzt er uns einen Floh ins Ohr.
Abbruch mitten im Versuchsaufbau: Er spielt mit uns, provoziert und fordert uns heraus: Dieses hast du geschluckt. Nun nimm jenes. Folgst du mir voller Vertrauen oder rufst du: Aus Bis Hierher Und Nicht Weiter? Was kann ich dir noch zumuten? Wie weit folgst du mir oder gehst mit? Für welche meiner reichen Gaben bist du empfänglich? Wann fühlst du dich verspottet? Diesen Dialog mit seinen wenigen Lesern unter den zahlreichen Käufern kann er sich leisten. Denn er ist eine Ikone. Jeder andere müßte dergleichen als Book on Demand in die Welt stoßen, drücken, zwingen. Ich schreibe für dich, du kleiner Tor, du Tor-Aspirant! scheint er zu rufen. Sag Bescheid, wenn du mich liest! (Dieser kleine Kalauer muß einer Nicht-Rezensentin erlaubt sein – einer Ikone selbstverständlich nicht.)
2
Hier schreibt ein Freier. Einer, der es geschafft hat, im Laufe seines Lebens alles Überkommene, Übernommene von Elternhaus, Kirche und Schule - Urteile, Vorurteile, Ideologien und Überzeugungen aller Art - aus sich herauszudestillieren und auf die Streckbank zu legen. Einer, der keine Selbstverständlichkeit kennt und nur Selt’nes nicht in Frage stellt. (Für ein Kind versteht sich alles von selbst. Die Ordnung, in die es hineingeboren wird, ist die Ordnung an und für sich. Es ist wie es ist. In der Jugend kommen die Fragen und – bestenfalls – die Neugier. Mit Eintritt in Familien- und Berufsleben enden Fragerei und Interesse am Wesen des Anderen. Festhalten des neuen Status quo. Alles bleibe, wie es geworden ist. Negation der Negation.)
Botho Strauß hat den biographischen Weg hin zu konventioneller Sicherheit ausgeschlagen. Je mehr Erfahrungen er sammelt, desto mehr Möglichkeiten sieht er. Er mixt die Elemente, schüttelt sie und rückt sie in ein neues, ungekanntes Licht. Hebt Schätze aus Bergwerken der Geschichte, der Sprache und der Phantasie. „Abteufen: Einen Schacht senkrecht in die Tiefe bohren“ (S. 161) Im Kapitel 6 des Doktor Faustus spricht Thomas Mann mit vergleichbarer symbolischer Intention von einer „altertümlich-neurotischen Unterteuftheit“ als „seelische(r) Geheim-Disposition einer Stadt“, deren Kennzeichen zahlreiche „Originale, Sonderlinge und harmlos Halb-Geisteskranke“ seien, „die in ihren Mauern leben und gleichsam, wie die alten Baulichkeiten, zum Ortsgebilde gehören“.
„Tiefer als die Grundbilder reichen weder Denken noch Geschehen: Labyrinth, Höhle, Maelstrom, Turm von Babylon.“ (S. 149) Ein „schönes Ungefähr“ (S. 33): Nebel, Schatten, Schleier. Drei Elemente des Teufels, des großen Allesverwirrers. Parallelweltliche Axiome. Doch nein: nicht parallel. Keine zwei Reiche, verbunden nur durch eine Tür. Kein Hie und Da. Nur ein Davor und Danach. Es ist die Aura um und hinter den Dingen. Immerdar, unmittelbar. Sie will nur wahrgenommen sein. Nichts ist nicht denkbar. Es gibt immer, wie alt man auch sei, etwas Noch-nicht-Gedachtes, Noch-nicht-Erfaßtes. Zusammenhänge, die bislang niemand sah. Und die es nicht tat-sächlich gibt. Die aber möglich sind. Und sind sie einmal gedacht (und publiziert), sind sie im Leben – und sei’s auch nur als Mauerblümchen. Utopische Fiktion, zum Beispiel, wirkt. Bringt auf Gedanken jene, die mit beiden Beinen fest am Boden kleben. Oder ist das naiv? Werden nur jene von Botho Strauß’ Betrachtungen angesteckt, die ohnehin glücklich verunsichert sind, die schon ein bißchen schweben, aber mit dem Kopf noch nicht durch die Decke passen? Botho Strauß – ein Geburtshelfer? Ein Katalysateur?
„Wenn wir wieder unter uns sind … Schreiben und Lesen Sache der wenigen wie zu den besten Zeiten des Abendlands. Wie werden wir in Entdeckungen schwelgen, nach dieser Dürre der Vergangenheitsentbehrung! Wie werden wir mit Wiedergefundenem unsere Tage verlängern. Sobald also die Schrift wieder ein Medium der Hinterlassenschaft und Lesen ein Ritus des Vermissens sein werden …“ (S. 161) Wie hemmungslos und hoffnungsfroh elitär!
Hier schreibt ein Freier heißt auch: Hier schreibt ein Spieler. Den Ernst des Lebens in Würde hinter sich gebracht. Peisinoe widerstanden. Das macht einsam. Doch jetzt ist er wieder Kind. Und ernstet, spielend auf der Mundorgel wie mit Glasperlen.
3
Am Anfang des Buches die Sehnsucht, die Traurigkeit, die Einsamkeit eines Vaters, der seines Sohnes harrt. Vergeblich. Unvermischte, elementare Gefühle.
Am Schluß fünf leere Blätter: Soll man ein Strauß’sches Lexikon erstellen? Auf daß Neuwort und Mäander zu mehr als einem Rausche taugen?
Herzlichen Glückwunsch, Botho Strauß! Und Dank für dieses Geschenk zu Ihrem Geburtstag!
Botho Strauß: Das Schattengetuschel. Hanser Verlag 2024.
Abbildung: Botho Strauß, fotografiert von Oliver Mark in seinem Wald in der Uckermark, 2007 (Wikimedia Commons)